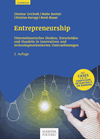Entrepreneurship
Unternehmerisches Denken, Entscheiden und Handeln in innovativen und technologieorientierten Unternehmen
Zusammenfassung
Das Lehrbuch präsentiert den aktuellen Stand der internationalen Entrepreneurshipforschung. Von der Geschäftsidee über die Frühphase bis zur Markteinführung und Etablierung zeigen die Autoren, wie neue Geschäftsmodelle entdeckt und entwickelt werden. Außerdem im Fokus: Entrepreneurship im sozialen und wissenschaftlichen Bereich. Geeignet sowohl für die Gründung von Unternehmen und junge, wachsende Unternehmen als auch für etablierte Unternehmen und NPOs.
In der 2. Auflage ergänzt um aktuelle Themen wie Lean-Start-up-Ansatz, Crowdfunding und -sourcing, unternehmerische Ökosysteme, Digitalisierung und Vernetzung wie in der Sharing Economy.
Schlagworte
- Kapitel Ausklappen | EinklappenSeiten
- I–XVI Titelei/Inhaltsverzeichnis I–XVI
- 1–30 Teil A Formen und Bedeutung unternehmerischen Handelns 1–30
- 1–14 1 Erscheinungsformen unternehmerischen Handelns 1–14
- 1.1 Unternehmertum und unternehmerisches Handeln
- 1.2 Entwicklung von Entrepreneurship als eigenständige Disziplin
- 15–30 2 Gesamtwirtschaftliche Bedeutung unternehmerischen Handelns 15–30
- 2.1 Unternehmertum und ökonomische Entwicklung
- 2.2 Fallbeispiel: Unternehmerisches Ökosystem in der Schweiz
- 31–156 Teil B Unternehmerische Gelegenheiten und Denkweisen 31–156
- 31–56 3 Opportunity Map des unternehmerischen Entscheidungsprozesses 31–56
- 3.1 Die Opportunity Map als Bezugsrahmen
- 3.2 Entstehungsursachen für unternehmerische Gelegenheiten
- 3.3 Grundtypen unternehmerischer Gelegenheiten
- 3.4 Wahrnehmung und Bewertung der unternehmerischen Gelegenheit
- 3.5 Entscheidung zur Ausschöpfung
- 3.6 Ergebnis des Ausschöpfens der unternehmerischen Gelegenheit
- 3.7 Zusammenfassung
- 57–84 4 Entstehung unternehmerischer Gelegenheiten 57–84
- 4.1 Unternehmerische Gelegenheiten: erkannt, entdeckt oder erschaffen?
- 4.2 Erklärungsansätze unternehmerischen Handelns : Causation, Effectuation und Bricolage
- 4.2.1 Causation
- 4.2.2 Effectuation
- 4.2.3 Bricolage
- 4.2.4 Zur Bedeutung von Causation, Effectuation und Bricolage im Entrepreneurship-Prozess
- 4.3 Entrepreneure als Entdecker
- 4.4 Entrepreneure als Schöpfer
- 4.5 Zusammenfassung
- 4.6 Fallstudie: Avrios
- 85–112 5 Bewertung und Wahrnehmung unternehmerischer Gelegenheiten 85–112
- 5.1 Der Wert einer unternehmerischen Gelegenheit
- 5.2 Einflussfaktoren auf den Bewertungsprozess
- 5.2.1 Personenbezogene Faktoren
- 5.2.2 Opportunity-bezogene Faktoren
- 5.3 Verfahren zur Bewertung unternehmerischer Gelegenheiten
- 5.3.1 Unternehmerische Gelegenheiten als Investitionsprojekt
- 5.3.2 Discounted-Cashflow-Verfahren
- 5.3.3 Entscheidungsbaumverfahren
- 5.3.4 Multiplikatorverfahren
- 5.3.5 Venture-Capital und First-Chicago-Methode
- 5.4 Zusammenfassung
- 5.5 Fallstudie: On
- 113–132 6 Prozesse und Methoden unternehmerischen Handelns 113–132
- 6.1 Historische Einordnung
- 6.2 Ungewissheit im unternehmerischen Prozess
- 6.3 Methoden der Ungewissheitsreduktion im unternehmerischen Prozess
- 6.3.1 Ursprünge und Einordnung
- 6.3.2 Effectuation als Prozess
- 6.3.3 Improvisation und Bricolage als Prozesse
- 6.3.4 Design Thinking als Prozess
- 6.3.5 Lean Startup als Prozess
- 6.3.6 Gründen in Komponenten
- 6.3.7 Ausblick Geschäftsmodelldesign und Geschäftsplanung
- 6.4 Zusammenfassung
- 6.5 Fallstudie: Salonmeister
- 133–156 7 Geschäftsmodell 133–156
- 7.1 Zur Bedeutung des Geschäftsmodells für den Gründungserfolg
- 7.2 Charakteristika der verschiedenen Gestaltungsthemen eines Geschäftsmodells
- 7.3 Kombination von Gestaltungsthemen in einem Geschäftsmodell
- 7.4 Geschäftsmodell und interne Organisation
- 7.5 Design von Geschäftsmodellen
- 7.6 Fallstudie: Hitflip Media Trading
- 157–264 Teil C Ressourcenbeschaffung zur Nutzung unternehmerischer Gelegenheiten 157–264
- 157–184 8 Organizational Capital als intangible Ressource 157–184
- 8.1 Intellektuelles Kapital
- 8.2 Die Organisation
- 8.2.1 Unternehmenspersönlichkeit
- 8.2.2 Rechtsform
- 8.2.3 Bürokratie (Red Tape)
- 8.2.4 Rechtsanwalt und Steuerberater
- 8.2.5 Beirat und Coaches
- 8.3 Geistiges Eigentum (Intellectual Property)
- 8.3.1 Patente
- 8.3.2 Gebrauchsmuster
- 8.3.3 Marke
- 8.3.4 Geschmacksmuster
- 8.3.5 Urheberrecht
- 8.3.6 Hinweise zum Umgang mit Schutzrechten
- 8.4 Institutionen und Prozesse zu gewerblichen Schutzrechten
- 8.4.1 Institutionen
- 8.4.2 Arbeitnehmererfindungen
- 8.4.3 Schutzrechtsanmeldung
- 8.4.4 Verwertung von Patenten
- 8.5 Verträge
- 8.6 Versicherungen
- 8.7 Zusammenfassung
- 8.8 Fallstudie: PURON
- 185–208 9 Human Capital als intangible Ressource 185–208
- 9.1 Begriff und Definitionen
- 9.2 Elemente des Humankapitals
- 9.2.1 Ausbildung
- 9.2.2 Erfahrung
- 9.2.3 Wissen und Fähigkeiten
- 9.3 Persönlichkeit
- 9.4 Die Gründungsentscheidung
- 9.4.1 Unternehmerische Absicht
- 9.4.2 Selbstwirksamkeit
- 9.5 Unternehmerteams
- 9.5.1 Heterogenität der Fähigkeiten in Teams
- 9.5.2 Teamrollen
- 9.5.3 Teamprozesse
- 9.6 Zusammenfassung
- 9.7 Fallstudie: Incelltec
- 209–234 10 Social Capital als intangible Ressource 209–234
- 10.1 Bedeutung von Social Capital für den Gründungserfolg
- 10.2 Charakteristika sozialer Verbindungen
- 10.3 Analyse sozialer Netzwerke
- 10.4 Kosten-Wert-Relation der Netzwerkbildung
- 10.5 Fallstudie: ComfyLight
- 235–264 11 Financial Capital als tangible Ressource 235–264
- 11.1 Zur Rolle der Finanzierung für junge Unternehmen
- 11.2 Finanzierungsplanung
- 11.3 Bootstrapping und Finanzierung durch Verwandte und Freunde
- 11.4 Business Angels
- 11.5 Venture Capital
- 11.6 Corporate Venture Capital
- 11.7 Crowdfunding
- 11.8 Fremdkapital von Banken
- 11.9 Öffentliche Fördermittel als Finanzierungsinstrument
- 11.10 Zusammenfassung
- 11.11 Fallstudie: Policen Direct
- 265–378 Teil D Grundformen unternehmerischen Handelns 265–378
- 265–290 12 Geschäftsplanung 265–290
- 12.1 Pläne und Unternehmen
- 12.2 Definitionen des Geschäftsplans
- 12.3 Adressaten des Geschäftsplans
- 12.4 Prozess der Geschäftsplanung
- 12.5 Elemente des Geschäftsplans
- 12.5.1 Geschäftsidee
- 12.5.2 Markt
- 12.5.3 Marketing
- 12.5.4 Gründerteam, Management, Organisation
- 12.5.5 Realisations- und Finanzplanung
- 12.5.6 Chancen und Risiken
- 12.5.7 Executive Summary
- 12.6 Zusammenfassung
- 12.7 Fallstudie: MRI.TOOLS
- 291–318 13 Markteintritt, Marketing und Positionierung 291–318
- 13.1 Markteintritt als Realisierung der Unternehmensgründung
- 13.2 Markteintrittsstrategieprozess
- 13.2.1 Markteintrittsstrategieentwicklung
- 13.2.2 Zielkundenbestimmung bei jungen Unternehmen
- 13.2.3 Marktanalyse und Identifikation der Markteintrittsbarrieren
- 13.2.4 Optionen und Zeitpunkt des Markteintritts
- 13.3 Marketing-Mix
- 13.3.1 Produktpolitik
- 13.3.2 Preispolitik
- 13.3.3 Vertriebspolitik
- 13.3.4 Kommunikationspolitik
- 13.4 Zusammenfassung
- 13.5 Fallstudie: Twitch.tv
- 319–348 14 Wachstumsplanung und Wachstumsmanagement 319–348
- 14.1 Wachstumsunternehmen: Von Mäusen und Gazellen
- 14.2 Wachstumstheorien und -modelle
- 14.2.1 Traditionelle Erklärungsmodelle
- 14.2.2 Moderne Erklärungsansätze der Entrepreneurship-Forschung
- 14.2.3 Kritische Würdigung und ganzheitliche Modellentwicklung
- 14.3 Wachstumsprozesse junger Unternehmen
- 14.3.1 Wachstumsfördernde und -hemmende Faktoren
- 14.3.2 Methoden der Wachstumsplanung
- 14.3.3 Wachstumsstrategien
- 14.3.4 Wachstumsmanagement
- 14.4 Zusammenfassung
- 14.5 Fallstudie: getAbstract
- 349–378 15 Unternehmensaustritt 349–378
- 15.1 Unternehmensaustritt als Teil des unternehmerischen Handlungsprozesses
- 15.2 Exit-Strategien: Möglichkeiten zur Realisierung des Unternehmenswerts
- 15.2.1 Börsengang
- 15.2.2 Unternehmensverkauf
- 15.2.3 Liquidation
- 15.2.4 Phasenabhängigkeit der Exit-Alternativen
- 15.3 Einflussfaktoren auf die Entscheidung zum Unternehmensaustritt
- 15.3.1 Entrepreneur
- 15.3.2 Unternehmen
- 15.3.3 Umwelt
- 15.4 Auswirkungen des Unternehmensaustritts
- 15.5 Unternehmensaustritt und Neuanfang: Serial Entrepreneurship
- 15.6 Zusammenfassung
- 15.7 Fallstudie: DeinDeal
- 379–452 Teil E Sonderformen unternehmerischen Handelns 379–452
- 379–408 16 Corporate Entrepreneurship 379–408
- 16.1 Der Gedanke des Corporate Entrepreneurship
- 16.2 Dimensionen, Modelle, Ausprägungsformen
- 16.2.1 Dimensionen
- 16.2.2 Modelle
- 16.2.3 Ausprägungsformen
- 16.3 Corporate Entrepreneurship und Management
- 16.3.1 Entwicklung einer unternehmerischen Organisation
- 16.3.2 Nachhaltige Verankerung einer unternehmerischen Kultur
- 16.4 Corporate Entrepreneurship und Open Innovation
- 16.4.1 Closed Innovation
- 16.4.2 Open Innovation
- 16.5 Zusammenfassung
- 16.6 Fallstudie: P&G und der Passion Club
- 409–426 17 Academic Entrepreneurship 409–426
- 17.1 Definition und Ausprägungen
- 17.2 Hochschulgesetze und Arbeitnehmererfindungsgesetz
- 17.3 Technologietransfer
- 17.3.1 Lizenzierung, Patentverkauf und Drittmittelprojekte
- 17.3.2 Ausgründungen (Spin-offs)
- 17.4 Prozesse im Rahmen einer Ausgründung
- 17.5 Ausgründungsförderung
- 17.6 Forschung zu akademischem Unternehmertum
- 17.7 Ausgründungen als gesamtwirtschaftliches Innovationselement
- 17.8 Zusammenfassung
- 17.9 Fallstudie: RWTH Aachen
- 427–452 18 Social Entrepreneurship 427–452
- 18.1 Einführung
- 18.2 Entstehung von Social Entrepreneurship
- 18.3 Der Social Entrepreneur
- 18.4 Einordnung in den Kontext der Wirtschaftswissenschaften
- 18.5 Messung des Social Impact
- 18.6 Finanzierungformen für Social Entrepreneurs
- 18.7 Zusammenfassung
- 18.8 Fallbeispiel: Jivana Vitality
- 453–494 Literatur 453–494
- 495–498 Stichwortverzeichnis 495–498