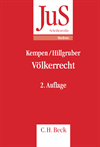Völkerrecht
Zusammenfassung
Das Lehrbuch behandelt die Funktionsweise, die Rechtsquellen und die wesentlichen Inhalte des Völkerrechts. Vor dem Hintergrund der wachsenden Bedeutung des Völkerrechts für die juristische Ausbildung bietet es einen dem Studium angemessenen tiefen Einblick in die Materie. Neben den Grundlagen der Völkerrechtsordnung mit ihren Rechtssubjekten werden beispielsweise die neuesten Entwicklungen im Bereich der Menschenrechte, der bedeutendsten Internationalen Organisationen und der Internationalen Strafgerichtsbarkeit dargestellt.
Die verständliche und präzise Aufarbeitung des Rechtsgebietes eignet sich für alle Studierenden des Völkerrechts. Daneben bietet es Schwerpunktstudierenden die Möglichkeit, ihr Wissen zu vertiefen. Als ideale Ergänzung zur Lektüre des Lehrbuchs empfiehlt sich das parallele Arbeiten mit dem Fallbuch zum Völkerrecht derselben Autoren.
- Kapitel Ausklappen | EinklappenSeiten
- I–XIX Titelei/Inhaltsverzeichnis I–XIX
- 1–15 1. Kapitel. Geschichte und Geltungsgrund des Völkerrechts 1–15
- § 1. Völkerrecht: Begriff und Abgrenzungen
- § 2. Geschichte des Völkerrechts
- I. Das Spanische Zeitalter (1494 – 1648)
- II. Das Französische Zeitalter (1648 – 1815)
- III. Das Englische Zeitalter (1815 – 1919)
- IV. Die Zeit von 1919 bis 1945
- V. Die Zeit nach 1945: Entwicklungstendenzen des Völkerrechts
- § 3. Rechtsqualität und Geltungsgrund des Völkerrechts
- § 4. Das Verhältnis von Völkerrecht und nationalem Recht
- Fragen und Antworten zu Kapitel 1
- 17–52 2. Kapitel. Die Völkerrechtssubjekte 17–52
- § 5. Die Staaten
- I. Der Begriff des Staates im völkerrechtlichen Sinne
- 1. Staatsvolk
- 2. Staatsgebiet
- 3. Effektive Staatsgewalt
- II. Bedeutung und Wirkung der Anerkennung
- 1. Die herrschende Meinung von der bloß deklaratorischen Wirkung der Anerkennung
- 2. Kritik an der herrschenden Meinung
- 3. Die Anerkennung eines Neustaates als statusverleihender (konstitutiver) Akt
- 4. Rechtspflicht zur Anerkennung?
- 5. Rechtspflicht zur Nichtanerkennung
- 6. Verbot vorzeitiger Anerkennung
- 7. Form der Anerkennung
- 8. Exkurs: Die Anerkennung von Regierungen
- 9. Souveränität als Attribut der Staatlichkeit im völkerrechtlichen Sinne
- III. Gliedstaaten von Bundesstaaten
- IV. Das de facto-Regime
- § 6. Internationale Organisationen
- § 7. Individuen
- § 8. NGOs
- § 9. Völker, Volksgruppen, Minderheiten
- § 10. Sonstige Völkerrechtssubjekte
- I. Völkerrechtssubjekte kraft Herkommens (Heiliger Stuhl, Malteserorden, IKRK)
- 1. Heiliger Stuhl
- 2. Malteserorden
- 3. Das internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK)
- II. Aufständische
- III. Transnationale Unternehmen?
- Fragen und Antworten zu Kapitel 2
- 53–103 3. Kapitel. Die Völkerrechtsquellen 53–103
- § 11. Begriff und Arten
- § 12. Die Bedeutung von Art. 38 IGH-Statut für die Rechtsquellenlehre
- § 13. Die völkerrechtlichen Verträge
- I. Begriff und Einteilung der Verträge
- II. Vertragsschluss
- III. Vorbehalte zu völkerrechtlichen Verträgen
- IV. Inkrafttreten, Hinterlegung und Registrierung
- V. Der Geltungsbereich völkerrechtlicher Verträge
- VI. Vertragsänderung und Modifikation
- VII. Die Auslegung völkerrechtlicher Verträge
- VIII. Ungültigkeit, Beendigung und Suspendierung von Verträgen
- § 14. Das Völkergewohnheitsrecht
- I. Begriff und Bedeutung
- II. Die Staatenpraxis als objektives Element
- 1. Die rechtserzeugenden Akteure
- 2. Erscheinungsformen der Staatenpraxis
- 3. Dauer und Nachhaltigkeit als Voraussetzung
- 4. Einheitlichkeit der Praxis
- 5. Verbreitung der Praxis
- 6. Der persistent objector
- III. Die opinio iuris als subjektives Element
- IV. Nachweis bestehenden Gewohnheitsrechts
- V. Ius cogens (zwingendes Völkergewohnheitsrecht)
- VI. Verträge und Gewohnheitsrecht
- VII. Die Vereinten Nationen und Gewohnheitsrecht
- § 15. Allgemeine Rechtsgrundsätze
- § 16. Hilfsmittel zur Feststellung von Völkerrechtsnormen
- I. Gerichtsentscheidungen
- II. Lehrmeinung
- § 17. Weitere potentielle Rechtsquellen
- I. Einseitige Akte
- II. Rechtserzeugung in internationalen Organisationen
- III. „Soft law“
- Fragen und Antworten zu Kapitel 3
- 105–128 4. Kapitel. Völkerrechtlicher Status der Staaten 105–128
- § 18. Der Territorialstatus
- I. Umfang des Staatsgebietes
- II. Abgrenzung des Staatsgebietes
- III. Gebietserwerb
- IV. Territoriale Souveränität
- § 19. Personalstatus
- I. Die Staatsangehörigkeit natürlicher Personen
- II. Die Staatszugehörigkeit juristischer Personen
- III. Die Personalkompetenz, insbesondere die Ausübung diplomatischen Schutzes
- § 20. Die Kompetenz zur Regelung extraterritorialer Sachverhalte
- § 21. Staatenuntergang und -nachfolge
- I. Staatenuntergang
- II. Staatennachfolge
- 1. Die Sukzessionstatbestände
- 2. Das Recht der Staatennachfolge
- Fragen und Antworten zu Kapitel 4
- 129–163 5. Kapitel. Internationale Organisationen 129–163
- § 22. Geschichtliche Entwicklung
- § 23. Allgemeine Grundlagen und Abgrenzung
- § 24. Entstehung und Untergang
- I. Der Gründungsvertrag
- II. Untergang und Sukzessionsfragen
- § 25. Mitgliedschaft
- § 26. Organe und Struktur
- § 27. Aufgaben, Befugnisse und Immunitäten
- I. Aufgaben und Befugnisse
- II. Immunitäten
- § 28. Haftung
- § 29. Die Vereinten Nationen
- I. Die Ziele der Vereinten Nationen
- II. Die Organe der Vereinten Nationen
- 1. Generalversammlung
- 2. Sicherheitsrat
- 3. Wirtschafts- und Sozialrat (ECOSOC)
- 4. Internationaler Gerichtshof
- 5. Sekretariat
- 6. Treuhandrat
- III. Reform der UN
- § 30. Die Europäische Union
- I. Die Rechtsnatur der EU
- II. Die Ziele der EU
- III. Die Organe der EU
- 1. Das Europäische Parlament (EP), Art. 14 EUV, Art. 223 ff. AEUV
- 2. Der Europäische Rat, Art. 15 EUV, Art. 235 f. AEUV
- 3. Der Rat, Art. 16 EUV, Art. 237 AEUV
- 4. Die Europäische Kommission (Kommission), Art. 17 f. EUV, Art. 244 ff. AEUV
- 5. Der Europäische Gerichtshof, Art. 19 EUV, Art. 251 ff. AEUV
- 6. Die Europäische Zentralbank, Art. 127 ff., Art. 282 ff. AEUV und der Rechnungshof, Art. 285 ff. AEUV
- § 31. Die NATO
- I. Gründung und Entwicklung der NATO
- 1. Die Gründung der NATO
- 2. 1949–1989
- 3. 1990 – 2000
- 4. 2001 – heute
- II. Ziele der NATO
- III. Struktur und Aufbau der NATO
- IV. Rechtsnatur der NATO
- V. Verfassungsrechtliche Aspekte
- Fragen und Antworten zu Kapitel 5
- 165–192 6. Kapitel. Völkerrechtliche Rechtsbeziehungen zwischen den Staaten 165–192
- § 32. Die Grundpflichten der Staaten
- I. Einleitung
- II. Der Grundsatz der souveränen Staatengleichheit
- III. Der Grundsatz der territorialen Integrität und politischen Unabhängigkeit und das Interventionsverbot
- 1. Entwicklung des Interventionsverbotes
- 2. Inhalt des Interventionsverbotes
- 3. Interventionsverbot im Verhältnis zwischen den Vereinten Nationen und ihren Mitgliedstaaten
- IV. Immunitäten
- 1. Die Staatenimmunität
- 2. Immunität von staatlichen Funktionsträgern
- 3. Immunität von Staatsunternehmen
- 4. Ausnahmen
- 5. Act of State Doctrine
- § 33. Diplomaten- und Konsularrecht
- I. Einführung
- II. Die Aufgaben diplomatischer Missionen
- III. Aufnahme und Beendigung diplomatischer Beziehungen
- IV. Rechtsstellung der Diplomaten
- 1. Die Mitglieder der diplomatischen Mission
- 2. Die Vorrechte, Immunitäten und Befreiungen der Diplomaten
- V. Diplomatisches Asyl und diplomatischer Schutz
- 1. Diplomatisches Asyl
- 2. Diplomatischer Schutz
- VI. Konsularrecht
- § 34. Die völkerrechtliche Verantwortlichkeit
- I. Einleitung
- II. Das völkerrechtliche Delikt
- 1. Zurechenbarkeit
- 2. Völkerrechtsverletzung
- III. Rechtfertigungsgründe
- 1. Einwilligung
- 2. Selbstverteidigung
- 3. Höhere Gewalt
- 4. Notlage und Notstand
- 5. Gegenmaßnahmen
- IV. Ausschluss der Staatenverantwortlichkeit
- V. Rechtsfolgen
- Fragen und Antworten zu Kapitel 6
- 193–252 7. Kapitel. Friedenssicherung, friedliche Streitbeilegung und internationale Gerichtsbarkeit 193–252
- § 35. Die Entwicklung des völkerrechtlichen Friedenssicherungssystems – ein historischer Abriss
- § 36. Friedenssicherung im Rahmen der Vereinten Nationen
- I. Befugnisse des Sicherheitsrates nach Kapitel VI der UN-Charta
- II. Befugnisse des Sicherheitsrates nach Kapitel VII der UN-Charta
- 1. Rechtsbindung und Verfahrensherrschaft des Sicherheitsrates bei Anwendung des Kapitels VII
- 2. Überblick über die Entwicklung der Praxis zu Kapitel VII UN-Charta
- 3. Typologie der Zwangsmaßnahmen
- 4. Die Inanspruchnahme von Nichtmitgliedern
- 5. Der Tatbestand des Art. 39 UN-Charta
- 6. Die möglichen Sanktionsmaßnahmen
- 7. Die Durchführung von Zwangsmaßnahmen
- III. Friedenssicherungsstreitkräfte („Peace-keeping Forces“) und UN-Beobachtergruppen („Oberserver Forces“)
- 1. Formen des peace-keepings
- 2. Rechtsgrundlage
- 3. Aufstellung, Rekrutierung und Status der Truppen
- § 37. Regionale Friedenssicherung
- § 38. Das allgemeine Gewaltverbot
- I. Geschichtliche Entwicklung
- II. Gewaltanwendung und -drohung i. S. d. Art. 2 Ziff. 4 UN-Charta
- III. Die Geltung des Gewaltverbots in den internationalen Beziehungen
- IV. Ausnahmen vom Gewaltverbot
- 1. Militärische Zwangsmaßnahmen nach Art. 39 i. V. m. 42 UN-Charta
- 2. Das Selbstverteidigungsrecht nach Art. 51 UN-Charta
- 3. Der Schutz eigener Staatsangehöriger im Ausland
- 4. Humanitäre Intervention
- § 39. Friedliche Streitbeilegung
- I. Mittel der friedlichen Streitbeilegung
- II. Die internationale Schiedsgerichtsbarkeit
- § 40. Internationale Gerichtsbarkeit
- I. Der Ständige Internationale Gerichtshof
- II. Der Internationale Gerichtshof
- Fragen und Antworten zu Kapitel 7
- 253–270 8. Kapitel. Humanitäres Völkerrecht 253–270
- § 41. Regelungsgegenstand und Geschichte des humanitären Völkerrechts
- § 42. Die heutigen Rechtsgrundlagen des humanitären Völkerrechts
- § 43. Einige grundlegende Begriffe des humanitären Völkerrechts
- I. Der internationale und nicht-internationale (innerstaatliche) bewaffnete Konflikt
- II. „Kombattant“ und „geschützte Person“
- III. Der kriegsvölkerrechtliche Status terroristischer Kämpfer und die Praxis gezielter Tötungen
- § 44. Neutralität
- § 45. Einige grundlegende Regeln des humanitären Völkerrechts
- I. Das „Genfer Recht“
- II. Das „Haager Recht“
- 1. Regelung der Kampfmethoden
- 2. Regelung der Schädigungsziele
- § 46. Schutz im Bürgerkrieg
- § 47. Die Durchsetzung des humanitären Völkerrechts
- Fragen und Antworten zu Kapitel 8
- 271–294 9. Kapitel. Das Selbstbestimmungsrecht der Völker 271–294
- § 48. Geschichte
- § 49. Der Träger des Selbstbestimmungsrechts
- § 50. Der Gewährleistungsinhalt des Selbstbestimmungsrechts
- I. Das äußere Selbstbestimmungsrecht
- II. Das innere Selbstbestimmungsrecht
- III. Das wirtschaftliche Selbstbestimmungsrecht
- § 51. Selbstbestimmungsrecht und Drittstaaten
- Fragen und Antworten zu Kapitel 9
- 295–319 10. Kapitel. Internationaler und regionaler Menschenrechtsschutz 295–319
- § 52. Entwicklung des völkerrechtlichen Menschenrechtsschutzes
- § 53. Menschenrechtsschutz auf der Ebene der UN
- I. Die sog. charter-based mechanisms
- 1. Das sog. 1235-Verfahren
- 2. Das sog. 1503-Verfahren
- 3. Die Allgemeine Periodische Überprüfung
- II. Die sog. convention-based mechanisms
- 1. Ausgangspunkt: Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte von 1948
- 2. Die beiden Internationalen Pakte von 1966
- 3. Weitere Konventionen auf der Ebene der Vereinten Nationen
- § 54. Regionale Schutzmechanismen
- I. Europäische Konvention der Menschenrechte und Grundfreiheiten
- 1. Garantien der EMRK
- 2. Rechtsschutzsystem
- 3. Geltung im innerstaatlichen Recht; Bedeutung für das Europarecht
- 4. Weitere Menschenrechtsabkommen des Europarats
- II. Der interamerikanische Menschenrechtsschutz
- III. Die Afrikanische Charta der Rechte der Menschen und der Völker
- § 55. Völkergewohnheitsrechtlicher Menschenrechtsschutz
- § 56. Die Einteilung der Menschenrechte in verschiedene Generationen
- § 57. Sonderregeln für Menschenrechtsverträge?
- I. Besondere Auslegungsmaximen
- II. Vorbehalte zu Menschenrechtsverträgen
- III. Kündigung von Menschenrechtsverträgen
- IV. Staatennachfolge in Menschenrechtsverträge
- § 58. Universalität der Menschenrechte?
- Fragen und Antworten zu Kapitel 10
- 321–345 11. Kapitel. Völkerstrafrecht 321–345
- § 59. Definition
- § 60. Allgemeines
- § 61. Historische Entwicklung des Völkerstrafrechts
- § 62. Grundlagen und -prinzipien des Völkerstrafrechts
- I. Rechtsquellen
- II. Legalitätsprinzip: nullum crimen sine lege
- § 63. Exkurs: Das Weltrechtsprinzip
- § 64. Völkermord
- § 65. Kriegsverbrechen
- § 66. Verbrechen gegen die Menschlichkeit
- § 67. Das Verbrechen der Aggression
- § 68. Weitere völkerrechtliche Verbrechen
- § 69. Der Internationale Strafgerichtshof und die Internationalen Tribunale
- I. Die Internationalen Tribunale für Ruanda und für das ehemalige Jugoslawien
- 1. Die Rechtmäßigkeit der Errichtung der Straftribunale
- 2. Zuständigkeit und Rechtsprechung
- II. Der Internationale Strafgerichtshof
- 1. Die Gerichtsbarkeit des IStGH
- 2. Zusammensetzung und Verfahren
- 3. Kritik am IStGH
- III. Die Hybridgerichte für Sierra Leone und Kambodscha
- § 70. Weitere Methoden der Unrechtsbewältigung
- Fragen und Antworten zu Kapitel 11
- 347–357 Sachverzeichnis 347–357
- 358–358 Impressum 358–358