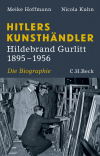Hitlers Kunsthändler
Hildebrand Gurlitt 1895-1956
Zusammenfassung
Der Handel mit geraubter Kunst ist das größte Thema der NS-Vergangenheit, das noch auf seine Aufarbeitung wartet. Der Name Hildebrand Gurlitt steht für dieses ungesühnte Unrecht, seit die Welt 2013 von der Entdeckung seiner Kunstsammlung erfuhr. Doch wer war der Mann, der als junger Museumsdirektor für die moderne Kunst kämpfte und sie dann als "entartet" verkaufte? Der als "Vierteljude" Raubkunst für Hitlers Führermuseum erwarb und daran Millionen verdiente?
Meike Hoffmann und Nicola Kuhn legen die erste Biographie von Hitlers berüchtigtem Kunsthändler vor. Als Pionier der modernen Kunst ist Hildebrand Gurlitt in den zwanziger Jahren vielbewundert - und wird 1930 als Museumsdirektor entlassen, als der Gegenwind von rechts zu stark wird. 1933 verliert er erneut seinen Posten. Doch kurz danach beginnt sein zweiter Aufstieg als Kollaborateur und Profiteur im Nationalsozialismus. Er verschafft dem Deutschen Reich Devisen durch den Verkauf von "Entarteter Kunst", geht nach Paris und erobert sich den Kunstmarkt in den besetzten Gebieten. Er wird reich mit Bildern, die jüdischen Sammlern geraubt wurden - und ist schon 1948 als Direktor des Kunstvereins in Düsseldorf wieder in Amt und Würden. Auf der Grundlage jahrelanger Recherchen erzählen Meike Hoffmann und Nicola Kuhn eine Geschichte von Tragik, Verbrechen und Verdrängung, die ihren Schatten bis in die Gegenwart wirft.
- Kapitel Ausklappen | EinklappenSeiten
- 1–10 Titelei/Inhaltsverzeichnis 1–10
- 11–12 Vorwort 11–12
- 13–21 Kapitel 1 Prolog: Eine doppelte Wende 13–21
- 22–38 Kapitel 2 Die Gurlitts: Ein Familienporträt 22–38
- 39–55 Kapitel 3 Schule der Kunst (1895 bis 1914) 39–55
- Eine Kindheit und Jugend in Dresden
- Cornelius Gurlitt und die künstlerische Moderne in Dresden
- Erste Begegnungen mit den Malern der «Brücke»
- Auf Linie gebracht: Nationalismus als Lehrinhalt
- 56–75 Kapitel 4 Schule des Lebens (1914 bis 1918) 56–75
- Eine Nation stürzt sich in den Krieg: Hildebrand Gurlitt wird Soldat
- Zwischen Abenteuer und Grauen: Erfahrungen an der Front
- Im Lande Ober-Ost
- Auftrag Kultur: Hildebrand Gurlitt in der Presseabteilung des Militärs
- Sehnsucht nach Frieden und einem neuen Leben
- 76–92 Kapitel 5 Netzwerke (1918 bis 1920) 76–92
- Aufbruch in die Selbstständigkeit
- Universitätsbeginn in Frankfurt und der Verlust der Schwester
- Studium in unruhiger Zeit
- Familienbande und Freundschaften fürs Leben
- 93–113 Kapitel 6 Die Kunst ruft – der Vater auch (1920 bis 1925) 93–113
- Eine Chance für die Avantgarde
- Der angehende Kunsthistoriker politisiert sich
- Auf dem Sprung: Gurlitt als Kustos, Kritiker und Künstlerfreund
- Eine Partnerin für das Leben
- 114–129 Kapitel 7 Vorerst am Ziel – vorerst am Ende (1925 bis 1930) 114–129
- Das Zwickauer König-Albert-Museum im Auftrieb
- Gegenwind von rechts: Gurlitt muss gehen
- 130–150 Kapitel 8 Vom Regen in die Traufe (1931 bis 1933) 130–150
- Intermezzo in Dresden mit einem Großauftrag: Die Sammlung Kirchbach
- Neubeginn in Hamburg beim Kunstverein
- Gurlitt in seinem Element, der Kunstverein als Forum
- Der Konflikt spitzt sich zu: Das zweite Aus
- 151–172 Kapitel 9 Zwischen Geradlinigkeit und taktischen Manövern (1933 bis 1937) 151–172
- Unter dem Radar: Aufbau einer neuen Existenz
- Als Berater zu Diensten: Gurlitt kauft für Kirchbach ein
- Häutungen: Offiziell Kunsthändler
- Gefahr zieht herauf: Die Verschärfung der NS-Gesetze
- 173–198 Kapitel 10 Der Pakt mit den Schergen (1937 bis 1941) 173–198
- Ein Feldzug gegen die Moderne: Beginn der Beschlagnahmungen
- Die Münchner Ausstellung «Entartete Kunst» als Fanal
- Geschäftsmann für die Nationalsozialisten
- 199–222 Kapitel 11 Im Auftrag des «Führers» (1941 bis 1944) 199–222
- Gelegenheit macht Profiteure
- Handel im Ausland: Gurlitt erweitert seinen Radius
- Chefeinkäufer für das «Führermuseum»
- Als Unterhändler unterwegs für deutsche Museen
- 223–243 Kapitel 12 Ein Lastauto voller Kunst (1944 bis 1947) 223–243
- Das Ende in Dresden
- Unterschlupf im fränkischen Aschbach
- Die Amerikaner kommen: Fragen an «Chiefdealer» Gurlitt
- Eine Nachkriegskindheit: Cornelius und Benita Gurlitt
- 244–263 Kapitel 13 Restitutionsversuche nach dem Krieg (1947 bis 1948) 244–263
- Weiße Westen: Gurlitt wird entnazifiziert
- Freigeist und Widerständler? Der einstige NS-Profiteur sucht sich Fürsprecher
- Als «Nutznießer» unter Verdacht: Eine Denunziation
- Heimholung einer Sammlung: Gurlitt erhält seine Bilder zurück
- 264–286 Kapitel 14 Neuer Anfang, alte Schuld (1945 bis 1947) 264–286
- Anknüpfungsversuche nach dem Krieg
- Auf Kundensuche: Wiedereinstieg in den Kunsthandel
- Deutschlandweit zerstreut: Von Depots und ausgelagerten Schätzen
- Unerwünscht: Versuche einer Rückkehr ans Museum
- Mission Dresden: Hildebrand Gurlitt engagiert sich in der alten Heimat
- Gedankenspiele zwischen Dresden und Krefeld
- 287–311 Kapitel 15 Ein gewichtiges Erbe (1948 bis 1956) 287–311
- Wieder in Amt und Würden: Gurlitt wird Direktor des Düsseldorfer Kunstvereins
- Ausstellungsmacher, Quartiermeister, Drahtzieher
- Wiedergutmachungen: Rückgaben nach Frankreich
- Alte Freunde, neue Heimlichkeiten
- Tod eines Antreibers: Gurlitt stirbt im Zenit seines Düsseldorfer Schaffens
- 312–329 Kapitel 16 Vom Dunkel ins Scheinwerferlicht 312–329
- Eine Sammlung wird entdeckt
- Ein Leben im Verborgenen: Der Sohn eines übergroßen Vaters
- Die Sammlung Gurlitt und die Washingtoner Prinzipien
- Alarmstufe Kunst: Die Taskforce wird gegründet
- 330–336 Kapitel 17 Eine Sammlung sucht ihren Ort 330–336
- Eine moralische Pflicht: Die Bundesregierung will die Restitutionen übernehmen
- Das Kunstmuseum Bern als neue Bleibe
- Im Erbstreit
- 337–346 Kapitel 18 Folgen für öffentliche Museen und private Sammlungen 337–346
- Perspektivwechsel auf die eigenen Bestände
- Kirchners «Straßenszene»: Eine Restitution eröffnet die Diskussion in Deutschland
- Alte Fristen, neue Gesetze
- Ausnahmefall Privatmuseum
- 347–400 Anhang 347–400
- Dank
- Anmerkungen
- Archive und Quellen
- Bildnachweis
- Personenregister
- 401–401 Zum Buch 401–401
- 401–401 Über die Autorinnen 401–401