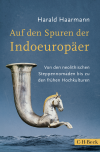Auf den Spuren der Indoeuropäer
Von den neolithischen Steppennomaden bis zu den frühen Hochkulturen
Zusammenfassung
Zum Buch
Seit mehr als 3000 Jahren werden von Indien über Persien bis nach Europa indoeuropäische Sprachen gesprochen. Wo liegen die Ursprünge dieser Sprachfamilie? Wie und wann sind die unterschiedlichen Sprachzweige entstanden? Der renommierte Indogermanist Harald Haarmann schildert anschaulich, was wir heute über die Entstehung der indoeuropäischen Sprachen und Kulturen und ihre frühen Verbreitungswege wissen. Dabei gelingt es ihm eindrucksvoll, linguistische Befunde mit archäologischen Erkenntnissen und neuesten humangenetischen und klimageschichtlichen Forschungen in Beziehung zu setzen. Über sprachliche Verwandtschaften hinaus zeigt er, welche Wirtschaftsweisen, Gesellschaftsformen und religiösen Vorstellungen die frühen Sprecher indoeuropäischer Sprachen vom östlichen Mittelmeer bis zum Indus gemeinsam hatten. Besondere Beachtung finden dabei die Verschmelzungsprozesse mit vorindoeuropäischen Sprachen und Zivilisationen. So entsteht ein faszinierendes Panorama der frühen "indoeuropäischen Globalisierung" vom Ende der letzten Eiszeit bis zu den frühen Hochkulturen in Griechenland, Italien, Kleinasien, Persien und Indien.
- Kapitel Ausklappen | EinklappenSeiten
- 1–10 Titelei/Inhaltsverzeichnis 1–10
- 11–22 Einleitung: Das Rätsel der Indoeuropäer 11–22
- Auf der Suche nach Sprachverwandtschaften
- Vom Volk zur Rasse: Indoeuropäer und Arier
- Das Hakenkreuz, ein arisches Symbol?
- 23–48 1. Die Urheimat in der südrussischen Steppe (11.– 8. Jahrtausend v. Chr.) 23–48
- Neolithische Übergänge: Viehnomaden im Osten, Ackerbauern im Westen
- Urheimat Anatolien? Neue humangenetische Erkenntnisse
- Naturraum Steppe
- Die Bedeutung des Pferdes für die frühen Hirtennomaden
- Hirtentum und Weidewirtschaft
- Vom Honigsuchen zum Honigsammeln
- Pflanzen und Tiere als Hinweise auf die Urheimat
- Indoeuropäer und Uralier: Frühe Konvergenzen
- 49–68 2. Proto-indoeuropäische Sprache und Kultur (ab dem 7. Jahrtausend v. Chr.) 49–68
- Elementare Strukturen und Eigenschaften
- Das Lautsystem
- Der grammatische Bau
- Die Syntax
- Namen als ethnische Identitätsmarker
- Ethnonyme
- Personennamen
- Namentypen in den Regionalkulturen
- Funktionale Varianten des Proto-Indoeuropäischen
- Mythopoetischer Sprachstil
- Ritueller Sprachgebrauch
- Spezialterminologien für Weidewirtschaft und Pflanzenkultivation
- 69–92 3. Frühe Steppennomaden: Gesellschaftsformen und Weltbilder (ab dem 7. Jahrtausend v. Chr.) 69–92
- Proto-indoeuropäische Regionalkulturen
- Elshan-Kultur (spätes 8. und 7. Jahrtausend v. Chr.)
- Samara-Kultur (ca. 6000 – ca. 5000 v. Chr.)
- ChvalynskKultur (ca. 5000 – ca. 4500 v. Chr.)
- Srednij Stog (ca. 4500 – ca. 3350 v. Chr.)
- JamnajaKultur (ca. 3600 – ca. 2000 v. Chr.)
- UsatovoKultur (ca. 3300 – ca. 2900 v. Chr.)
- Frühe soziale Hierarchien und patriarchalische Herrschaftsstrukturen
- Familien, Sippen, Clans
- Umrisse einer protoindoeuropäischen Mythologie
- Sozialstrukturen im Spiegel der mythischen Überlieferung
- Beseelte Natur: Geister, Bären, Flussgöttinnen
- Hirtengott und Pferdegöttin
- Die ältesten Himmelsgötter
- Die Mythen vom Weltende und der Tochter des Herrschers
- 93–106 4. Kontakte mit Ackerbauern im Westen (ab dem 5. Jahrtausend v. Chr.) 93–106
- Die Annahme des «Agrarpakets»
- Technologische Innovationen
- Die Verarbeitung von Gold
- Die Einführung von Rad und Wagen
- Alteuropäischindoeuropäische Kooperation in der Transporttechnologie
- Der Streitwagen – eine kleine Kulturgeschichte
- 107–126 5. Die erste Migration der Steppennomaden (ab Mitte des 5. Jahrtausends v. Chr.) 107–126
- Migration und ihre Motivation
- Indizien für die Wanderungen der Nomaden
- Szepter mit Pferdekopfverzierung
- Merkmale des «indoeuropäischen» Genoms in Ost- und Südosteuropa
- Motive in den Felsbildern Eurasiens
- Primäre Indoeuropäisierung: Anpassung an die Elite und Sprachwechsel
- Machtübernahme im Handelszentrum von Varna
- Kulturentwicklung unter einer indoeuropäischen Elite
- Sprachwechsel der alteuropäischen Bevölkerung in Südosteuropa
- Modellfall Mauritius: Die Entstehung einer Kreolsprache
- 127–154 6. Die Auflösung des ProtoIndoeuropäischen (ab 4000 v. Chr.) 127–154
- Richtung Süden: Die Auseinandersetzung mit den Alteuropäern
- Umbruch und balkanischaltägäische Kulturdrift
- Helladische Landnahme
- Interessenausgleich zwischen Indoeuropäern und Alteuropäern
- Erzähltraditionen im Kulturkontakt
- Handwerk und Figurinen
- Die Kontinuität des vorindoeuropäischen Göttinnenkults
- Richtung Osten: Die Erkundung Zentralasiens und Südsibiriens
- Die AfanasevoKultur (ca. 3500 – ca. 2500 v. Chr.)
- Die AndronovoKultur (ca. 2300 – ca. 900 v. Chr.)
- Die Auflösung der Grundsprache
- Centum, Satem und der Schwund der Laryngale
- Die indoeuropäische Restbevölkerung in der eurasischen Urheimat
- Frühe iranische Sprachen und Kulturen: Kimmerier, Skythen und Sarmaten
- Die Amazonen – Mythos und Wirklichkeit
- IndoIranisch als Makrogruppierung
- Die Armenier: Außenlieger im Kaukasus
- 155–184 7. Südosteuropa: Die Entstehung der hellenischen Kultur (ab dem 3. Jahrtausend v. Chr.) 155–184
- Wie aus Helladen Hellenen wurden
- Die vorgriechische Kulturlandschaft
- Akropolis: Die Hellenisierung der Stadt Athen
- Pelasgischgriechische Verschmelzungen
- Die Anfänge des Schiffsbaus und des Seehandels in der Ägäis
- Unter dem Patronat vorgriechischer Gottheiten
- Athene, die vielseitige Supergöttin
- Dionysos und die Ursprünge der Weinkultur
- Demeter, die Kornmutter
- Hephaistos, der göttliche Schmied
- Vom Ritual zum Theater
- Die Hellenen und ihre Staatswesen
- Die Polis: Das Modell des hellenischen Stadtstaats
- Vorgriechische Konzepte in der athenischen Demokratie
- Das mykenische kommunale Pachtsystem
- Das Griechische und seine Entwicklung
- 185–212 8. ApenninHalbinsel: Die Dominanz des Lateinischen (ab dem 2. Jahrtausend v. Chr.) 185–212
- Indoeuropäer in Italien
- Italische Sprachkulturen
- Römersein: ein schillernder Kulturbegriff
- Indoeuropäische Außenlieger: Veneter und Messapier
- Die Etrusker, Lehrmeister der Römer
- Etruskischrömische Kontakte
- Die Dominanz der etruskischen Kultur im alten Rom
- Aristokratische Namengebung nach etruskischem Vorbild
- Etruskischer Spracheinfluss im Lateinischen
- Die Legitimation römischer Vormacht
- Die Geburt einer Weltsprache
- Lateinisch: Von der Lokalsprache zur Weltsprache
- Assimilationsdruck in den römischen Provinzen
- Funktionen des geschriebenen und gesprochenen Latein
- Nichtrömer wechseln zum Lateinischen
- 213–224 9. Balkan: Zwischen römischer und griechischer Zivilisation (ab dem 2. Jahrtausend v. Chr.) 213–224
- Die römischgriechische Sprach- und Kulturgrenze
- Altbalkanische Stammesverbände und Königreiche
- Ein Mazedonier: Alexander der Große
- Die Thraker und ihr Gold
- Illyrische Stammesgruppen
- Fusionskultur: Das Albanische
- 225–248 10. Mittel- und Westeuropa: Kelten und Germanen (ab dem 2. Jahrtausend v. Chr.) 225–248
- Bis zur Atlantikküste: Keltische Kulturen und Sprachen
- Keltische Regionalkulturen
- Die Keltisierung der atlantischen Randzone
- Gallische Sprache und Kultur
- Akkulturation: Die Entstehung des Keltiberischen
- Germanische Kulturen, Sprachen und Staatsbildungen
- Die formative Periode des Germanischen
- Migrationen der Goten und ihre Spuren
- Frühe Germanenreiche
- Rechtskodifikationen: Leges barbarorum
- Germanischer Einfluss auf die ostseefinnischen Sprachen
- 249–262 11. Osteuropa: Slawen und Balten (ab dem 2. Jahrtausend v. Chr.) 249–262
- Die Ausgliederung des Slawischen
- Berührungen mit nichtslawischen Völkern
- Germanischslawische Kontakte
- Wechselbeziehungen zwischen Slawen und FinnoUgriern
- Die Ausgliederung des Baltischen
- Baltischfinnische Kontakte im Ostseeraum: Sesshaftigkeit versus Mobilität
- 263–274 12. Kleinasien: Anatolische Sprachen und Kulturen (ab dem 2. Jahrtausend v. Chr.) 263–274
- Hethiter und Luwier
- Sprachliche Ausgliederung
- Im Kontakt mit den autochthonen Völkern
- Nichtindoeuropäische Sprachen und Kulturen Anatoliens
- Hatti und Hattisch
- Hurriter und Hurritisch
- Der Kult der Artemis von Ephesos
- Das Phrygische: Ein indoeuropäischer Außenlieger
- 275–288 13. Von Zentralasien ins Iranische Hochland (ab dem 2. Jahrtausend v. Chr.) 275–288
- Die arische Kriegerkaste und das Reich von Mitanni
- Frühe Reichsbildungen iranischer Völker
- Skythen: Vom Altai bis zur Krim
- Meder: Von den Vasallen Assyriens zum eigenen Großreich
- Das Persische Großreich
- Das Reich der Parther
- Iranische Sprachen
- Ausgliederung
- Die persische Sprache
- Der Zoroastrismus
- 289–314 14. Indien: Draviden und Arier (2. Jahrtausend v. Chr.) 289–314
- Die Hochkultur der Draviden
- Die «Einwanderung» der Arier
- Die Landnahme arischer Steppennomaden
- Die Gesellschaft der frühen Arier im Spiegel des Rig Veda
- Kultursymbiosen
- Wirtschaft und Religion
- Sprachwechsel bei den Altdraviden und den Adivasi
- Vom Clan zum Großreich
- Vom Vedischen zum Sanskrit
- Das Prakrit und seine Nachfolger
- Indische Sprachen in Südostasien
- 315–320 15. Indoeuropäische Außenlieger in Westchina (2. Jahrtausend v. Chr.) 315–320
- Das Geheimnis der Mumien von Ürümchi
- Tocharische Sprache und Kultur
- 321–344 16. Experimente mit der Schrift: Von Linear B bis Ogham (1700 v. Chr. – 500 n. Chr.) 321–344
- Silbenschriften
- Linear B zur Schreibung des MykenischGriechischen
- Das KyprischSyllabische zur Schreibung des Griechischen in Altzypern
- Die anatolische Hieroglyphenschrift
- Die persische Version der Keilschrift
- Alphabetschriften
- Das «griechische» Alphabet – eine minoischgriechische Kooperation
- Die persische PehleviSchrift
- Germanische Runen
- Ogham: Eine Schriftschöpfung der Inselkelten
- Wulfila und die gotische Schrift
- Die armenische Schrift und das frühe Christentum
- 345–346 Epilog: Die indoeuropäische Globalisierung 345–346
- 347–361 Bibliographie 347–361
- 362–362 Nachweis der Karten und Abbildungen 362–362
- 363–368 Register 363–368