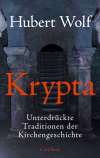Krypta
Unterdrückte Traditionen der Kirchengeschichte
Zusammenfassung
Tief unten in den Kellern der Kirchengeschichte, verborgen selbst für die meisten Historiker, liegen jahrhundertealte Traditionen begraben, von denen die Kirche heute nichts mehr wissen will. Hubert Wolf steigt mit archäologischem Spürsinn hinab in diese Krypta. Er entdeckt dort Frauen mit bischöflicher Vollmacht, Laien, die Sünden vergeben, eine Kirche der Armen – und andere Traditionen, die heute wieder aktuell werden könnten.
Der Vatikan setzt auf die lange und unabänderliche Tradition der heute gültigen Lehren und Regeln, die dem Papst und den Bischöfen eine unvorstellbare Machtfülle geben. Laien haben nichts zu melden, erst recht wenn sie Frauen sind. Weil es angeblich schon immer so war, gelten Reformen als Sakrileg. Höchste Zeit für einen frischen Blick auf die Geschichte: Päpste waren einmal in Gremien eingebunden, die sie kontrollierten, Frauen konnten Sünden vergeben, Laien hatten etwas zu sagen, Bischöfe wurden gewählt. Die katholische Kirche war lange ein breiter Strom mit vielen Nebenarmen – den der römische Zentralismus im 19. Jahrhundert kanalisierte. Dazu wurden Traditionen erfunden, an die bis heute selbst Historiker glauben. Hubert Wolf enthüllt an zehn Beispielen Vergessenes und Verdrängtes – und gewinnt daraus Reformideen für die Kirche von morgen.
- Kapitel Ausklappen | EinklappenSeiten
- 1–8 Titelei/Inhaltsverzeichnis 1–8
- 9–28 Zur Einleitung «Wir alle sind abgewichen» 9–28
- Päpstliche Schuldbekenntnisse einst und jetzt
- Reform als Wesensmerkmal der Kirche
- In der Krypta der Kirchengeschichte
- 29–44 1. Der Bischof Von allen gewählt 29–44
- «Der Papst ernennt die Bischöfe frei»
- Wie wird man Bischof? Ein Durchgang durch die Geschichte
- Was ist ein guter Bischof? «Nur einmal verheiratet»
- 45–60 2. Bischöfinnen Frauen mit Vollmacht 45–60
- Mächtige Äbtissinnen
- Äbtissinnenweihe und Bischofsweihe
- Bischöfe und Kardinäle ohne Weihe
- Kardinalinnen: Seit dem Zweiten Vatikanum undenkbar?
- 61–74 3. Das Domkapitel Kontrollorgan und Senat des Bischofs 61–74
- Der Bischof als absoluter Monarch
- Ausgerechnet Limburg: Ein kollegiales Gegenmodell
- Unterdrückung der kollegialen Leitung
- 75–92 4. Der Papst Kollege und nicht gegen Fehler gefeit 75–92
- «Die höchste, volle, unmittelbare und universale ordentliche Gewalt»
- Das Konstanzer Konzil: Oberhoheit des Konzils über den Papst
- Das Erste Vatikanum: Unfehlbarkeit und Primat des Papstes
- Die Ausblendung der konziliaren Option
- 93–114 5. Die Kardinäle Gegengewicht zur päpstlichen Macht 93–114
- Die Williamson-Affäre: Ein Papst der einsamen Entscheidungen
- Kleine Geschichte der Kardinäle
- Ein vatikanischer Sicherheitsrat
- Die Entmachtung der Kardinäle im zwanzigsten Jahrhundert
- Optionen gegen den autokratischen Führungsstil
- 115–128 6. Mönche und Nonnen Höchste Autorität durch radikale Nachfolge 115–128
- Der heilige Martin: Vollmacht ohne Weihe
- «Göttliche Kraft» durch Askese
- Die Erfindung der Privatbeichte in Irland
- Amt statt Nachfolge?
- 129–144 7. Die Gemeinden Primat der kleineren Einheit 129–144
- Subsidiarität: Ein Konzept der katholischen Soziallehre
- Die Kirche: Zentralistisch oder doch lieber subsidiär?
- Das Zweite Vatikanum und die Rolle der Laien
- Weltkirche gegen Ortskirche? Theologische Debatten
- «Der Hirt muss den Geruch seiner Herde annehmen»
- 145–158 8. Die Laien Keine unmündigen Schafe 145–158
- Gleichheit in der Theorie, Unterordnung in der Praxis
- Eigenkirchen: Die Herrschaft der Laien
- Vereine: Mündige Laien und der Geist der Revolution
- Die Stunde der Laien
- 159–176 9. Das Konzil von Trient Pluraler Katholizismus 159–176
- Das erfundene Konzil
- Mythos I: Das Tridentinische Seminar
- Mythos II: Das tridentinische Bischofsideal
- Trientische Weite oder tridentinische Enge?
- Mythos III: Die tridentinische Messe
- In der Tradition von Trient: Das Zweite Vatikanum
- 177–198 10. Franz von Assisi Option einer Kirche der Armen 177–198
- Ein Papst mit Namen Franziskus
- Von der Kirche der Armen zur reichen Papstkirche
- Der Ketzer und der Heilige: Brüder im Geiste
- Eine charismatische Gemeinschaft wird verkirchlicht
- Sprengkraft einer Utopie
- 199–208 Zum Schluss «Die Wahrheit, die aus der Geschichte kommt» 199–208
- Gefährliche Erinnerung
- Das Dogma besiegt die Geschichte
- Historische Verantwortung
- 209–217 Anmerkungen 209–217
- 218–231 Zum Weiterlesen 218–231
- 232–232 Zum Buch 232–232