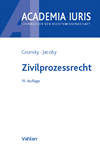Zivilprozessrecht
Zusammenfassung
Aus dem Inhalt
Die Bedeutung, zumindest die Grundzüge des Zivilprozessrechts zu beherrschen, wird insbesondere von Studenten gerne unterschätzt. Dieses Rechtsgebiet ist jedoch immer wieder Prüfungsgegenstand in Klausuren und im Examen. Das Lehrbuch bietet dem Einsteiger eine kompakte und zugleich umfassende Darstellung des prüfungsrelevanten Zivilprozessrechts. Es verschafft dem Leser einen gut verständlichen Überblick über die folgenden Themengebiete:
- Verfahrensgrundsätze
- Zuständigkeiten der Gerichte
- die Klage und besondere Klagearten
- Beteiligung Dritter am Rechtsstreit
- die Prozessvoraussetzungen
- Gang des Verfahrens sowie Beweisverfahren
- die Erledigung des Rechtsstreits und das Versäumnisverfahren
- das Urteil und seine Rechtskraft
- die Rechtsmittel
- Internationales Zivilprozessrecht.
Der dargestellte Stoff wird durch eine Vielzahl von Fall- und Formulierungsbeispielen sowie Übersichten veranschaulicht. So soll insbesondere Studierenden und Referendaren ein schneller Einstieg ins Zivilprozessrecht ermöglicht werden. Gleichzeitig eignet sich das Buch anhand der in den Beispielen verarbeiteten Entscheidungen und der im Kleindruck wiedergegebenen Details auch zur Vertiefung.
Die Autoren
Von Prof. Dr. Wolfgang Grunsky, RiOLG a.D., em. Professor an der Universität Bielefeld, Rechtsanwalt.
Fortgeführt von Prof. Dr. Florian Jacoby, Inhaber des Lehrstuhls für Bürgerliches Recht, Zivilverfahrens-, Insolvenz- und Gesellschaftsrecht an der Universität Bielefeld.
- Kapitel Ausklappen | EinklappenSeiten
- I–XXXII Titelei/Inhaltsverzeichnis I–XXXII
- 1–5 1. Kapitel. Die Funktion des Zivilprozesses: Zivilprozess und materielles Recht 1–5
- A. Selbsthilfe und Rechtsschutz
- I. Der Justizgewährungsanspruch
- II. Zivilgerichtsbarkeit
- III. Erkenntnis- und Vollstreckungsverfahren
- IV. Einstweiliger Rechtsschutz
- B. Verfahrensgrundsätze
- C. Verfahrenszweck
- 6–17 2. Kapitel. Gerichte und Organe der Rechtspflege 6–17
- A. Das Gericht
- I. Verfassungsrechtliche Stellung
- II. Gerichtsbarkeiten
- III. Zivilgerichtsbarkeit
- 1. Funktionelle Zuständigkeit der Spruchkörper
- 2. Freiwillige Gerichtsbarkeit
- IV. Instanzenzug
- V. Rechtsprechungskörper
- 1. Besetzung
- 2. Geschäftsverteilung
- VI. Der gesetzliche Richter
- B. Der Richter
- I. Grundsätze und richterliche Unabhängigkeit
- II. Sicherung der richterlichen Unparteilichkeit
- 1. Ausschließungsgründe
- 2. Ablehnung
- III. Funktionen
- 1. Einzelrichter
- 2. Vorsitzender
- 3. Berichterstatter
- 4. Beauftragter Richter
- 5. Ersuchter Richter
- C. Der Rechtspfleger
- D. Der Urkundsbeamte
- I. Protokollaufzeichnung
- II. Zustellung
- III. Ladung
- E. Der Gerichtsvollzieher
- F. Der Rechtsanwalt
- I. Anwaltszwang
- II. Rechtsverhältnisse
- 1. Berufsrechtliche Stellung
- 2. Mandatsverhältnis
- 18–25 3. Kapitel. Überblick über den Gang eines Verfahrens 18–25
- A. Die Klageerhebung
- I. Parteien
- II. Gericht
- III. Klageerwiderung
- IV. Vorbereitung der mündlichen Verhandlung
- B. Die mündliche Verhandlung
- I. Güteverhandlung
- II. Mündliche Verhandlung
- III. Das Verhalten des Beklagten
- 1. Säumnis des Beklagten
- 2. Anerkenntnis des Beklagten
- 3. Klageabweisung
- C. Die Beweisaufnahme
- D. Das Urteil
- I. Tenor
- II. Sach- und Prozessurteil
- III. End- und Zwischenurteil
- E. Die Berufung
- F. Die Revision
- G. Die Rechtskraft
- 26–51 4. Kapitel. Verfahrensgrundsätze 26–51
- A. Der Dispositionsgrundsatz
- I. Rechtfertigung und Bedeutung
- II. Folgerungen aus dem Dispositionsgrundsatz
- 1. Klage
- 2. Inhalt
- 3. Ende
- III. Durchbrechung des Dispositionsgrundsatzes
- 1. Nebenentscheidungen
- 2. Wohnraummiete
- 3. Richterliche Hinweise
- 4. Prozessleitung
- B. Der Verhandlungsgrundsatz
- I. Inhalt und Bedeutung
- II. Folgerungen aus dem Verhandlungsgrundsatz
- 1. Beibringungsgrundsatz
- 2. Sachstand
- 3. Vornehmlich gerichtliche Aufgaben
- a) Rechtsanwendung
- b) Beweiswürdigung
- III. Richterliche Hinweispflicht
- 1. Grundlagen
- 2. Anordnung persönlichen Erscheinens
- 3. Vermeidung von »Überraschungsentscheidungen«
- 4. Verletzung
- IV. Wahrheits- und Vollständigkeitspflicht
- 1. Grundsatz
- 2. Wahrheitspflicht
- 3. Vollständigkeit
- 4. Materiell-rechtliche Aufklärungspflichten
- 5. Folgen der Verletzung
- C. Die Grundsätze der Mündlichkeit, Unmittelbarkeit und Öffentlichkeit
- I. Mündlichkeit
- 1. Grundsatz
- 2. Ausnahmen und Modifikationen
- 3. Verstöße
- 4. Die mündliche Verhandlung
- II. Unmittelbarkeit
- III. Öffentlichkeit
- D. Der Grundsatz der freien richterlichen Beweiswürdigung
- I. Einleitung
- II. Freie Beweiswürdigung und objektive Beweislast
- III. Behauptungslast
- IV. Beweisführungslast
- E. Der Konzentrationsgrundsatz – Die Beschleunigung des Prozesses
- I. Lange Prozessdauer
- II. Konzentrationsgrundsatz
- 1. Grundsatz
- 2. Gerichtlich gesetzte Fristen
- 3. Allgemeine Prozessförderungspflicht
- 4. Nichterscheinen einer Partei
- 5. Einzelheiten
- 6. Flucht in die Säumnis
- 7. Form der Zurückweisung
- F. Der Anspruch auf rechtliches Gehör
- I. Rechtsgrundlage
- II. Inhalt
- III. Ausnahmen
- IV. Sanktionen
- 52–65 5. Kapitel. Das zuständige Gericht 52–65
- A. Allgemeine Grundsätze
- I. Arten der Zuständigkeit
- II. Prozessvoraussetzung
- 1. Prüfung von Amts wegen
- 2. Beurteilungsgrundlage
- 3. Zeitpunkt
- 4. Verweisung
- B. Die Rechtswegzuständigkeit
- I. Spezielle Rechtswegzuweisungen
- II. Abgrenzung bürgerlicher und öffentlich-rechtlicher Streitigkeiten
- 1. Einzelfälle
- 2. Vorfragen
- III. Mehrere Anspruchsgrundlagen
- C. Die sachliche Zuständigkeit
- I. Sachliche Zuständigkeit des Amtsgerichts
- 1. Streitwert
- 2. Spezialzuweisungen
- II. Sachliche Zuständigkeit des Landgerichts
- 1. Streitwert
- 2. Spezialzuweisungen
- III. Streitwertbestimmung
- D. Die örtliche Zuständigkeit
- I. Allgemeiner Gerichtsstand
- II. Besondere Gerichtsstände
- 1. Dinglicher Gerichtsstand
- 2. Erfüllungsort
- 3. Unerlaubte Handlung
- 4. Der Gerichtsstand der Widerklage (§ 33)
- III. Gerichtsstand kraft richterlicher Bestimmung (§ 36)
- E. Die funktionelle Zuständigkeit
- F. Zuständigkeit kraft Parteiverhaltens
- I. Zuständigkeitsvereinbarung
- 1. Gegenstand
- 2. Bestimmtes Rechtsverhältnis
- 3. Zeitpunkt
- II. Rügelose Einlassung zur Hauptsache
- 66–82 6. Kapitel. Die Partei 66–82
- A. Der Parteibegriff
- I. Parteistellung durch Klageschrift und Zustellung
- II. Parteiwechsel
- III. Parteierweiterung
- B. Die Parteifähigkeit
- I. Parteifähige Personen und Organisationen
- II. Die Bedeutung der Parteifähigkeit
- III. Verlust der Parteifähigkeit
- C. Die Prozessfähigkeit
- I. Prozessunfähigkeit
- II. Bedeutung der Prozessfähigkeit
- III. Gesetzliche Vertreter
- D. Prozessvollmacht und Postulationsfähigkeit
- I. Postulationsfähigkeit
- 1. Anwaltsprozess
- 2. Parteiprozess
- II. Prozessvollmacht
- 1. Umfang
- 2. Prüfung und Nachweis der Vollmacht
- 3. Prozessvoraussetzung
- E. Prozessführungsbefugnis und Prozessstandschaft
- I. Gesetzliche Prozessstandschaft
- 1. Partei kraft Amtes
- 2. Veräußerung
- 3. Revokatorische Klage
- II. Gewillkürte Prozessstandschaft
- III. Wirkungen der Prozessstandschaft
- IV. Verbandsklage
- V. Class action
- F. Die Prozesshandlungen der Parteien
- I. Prozesshandlungen
- 1. Voraussetzungen
- 2. Heilung
- 3. Widerruf
- 4. Doppelnatur
- II. Prozessverträge
- 83–99 7. Kapitel. Die Klage 83–99
- A. Die Bedeutung der Klage
- B. Klagearten
- I. Die Leistungsklage
- 1. Voraussetzungen der Leistungsklage
- 2. Rechtsschutzbedürfnis
- II. Die Feststellungsklage
- 1. Rechtsverhältnis
- 2. Feststellungsinteresse
- 3. Prüfung von Amts wegen
- 4. Urteilswirkungen
- 5. Zwischenfeststellungsklage
- III. Die Gestaltungsklage
- C. Die Klageerhebung – Klageinhalt
- I. Klageerhebung
- 1. Anhängigkeit
- 2. Terminsbestimmung
- 3. Rechtshängigkeit
- II. Klageinhalt
- 1. Gerichtliches Ermessen
- 2. Unmöglichkeit der genauen Bezifferung
- 3. Stufenklage
- 4. Nebenentscheidungen
- D. Die Wirkungen der Klageerhebung
- I. Perpetuatio fori
- II. Rechtshängigkeitssperre
- III. Klageänderung
- IV. Veräußerung der Streitsache
- V. Materiell-rechtliche Wirkungen
- E. Der Streitgegenstand
- I. Bedeutung des Streitgegenstands
- II. Bestimmung des Streitgegenstands
- 100–111 8. Kapitel. Besondere Klageformen 100–111
- A. Die Widerklage
- I. Voraussetzungen
- 1. Rechtshängigkeit der Klage
- 2. Inhalt
- 3. Konnexität und Zuständigkeit
- 4. Rechtsweg
- II. Das Verfahren über die Widerklage
- III. Besondere Widerklageformen
- 1. Eventualwiderklage
- 2. Drittwiderklage
- 3. Widerwiderklage
- 4. Zwischenfeststellungswiderklage
- B. Die objektive Klagehäufung
- I. Kumulative Klagehäufung
- 1. Zulässigkeit
- 2. Entstehung
- 3. Verfahren
- II. Eventuelle Klagehäufung
- C. Die subjektive Klagehäufung – Die Streitgenossenschaft
- I. Die einfache Streitgenossenschaft
- 1. Zulässigkeit
- 2. Entstehung
- 3. Verfahren
- 4. Prozessvoraussetzungen
- 5. Sachentscheidung
- II. Die notwendige Streitgenossenschaft
- 1. Notwendigkeit kraft Prozessrecht
- 2. Notwendigkeit kraft materiellen Rechts
- 3. Wirkungen
- 112–118 9. Kapitel. Die Beteiligung Dritter am Rechtsstreit – Nebenintervention und Streitverkündung 112–118
- A. Die Nebenintervention
- I. Rechtliches Interesse
- II. Beitritt
- III. Wirkungen der Nebenintervention im Hauptprozess
- 1. Bindungswirkung
- 2. Unwirksamkeit bei widersprüchlichen Erklärungen
- 3. Unwirksamkeit bei materiell-rechtlichen Wirkungen
- 4. Kosten
- IV. Interventionswirkung
- 1. Umfang
- 2. Gefahren
- B. Die Streitverkündung
- I. Verhältnis zum Dritten
- II. Hauptprozess
- III. Folgeprozess
- C. Weitere Formen der Beteiligung Dritter
- 119–123 10. Kapitel. Die Sachurteilsvoraussetzungen 119–123
- A. Begriff
- B. Die einzelnen Sachurteilsvoraussetzungen
- I. Prüfung von Amts wegen
- II. Prüfung auf Einrede
- C. Die Bedeutung der Sachurteilsvoraussetzungen
- I. Prüfung von Amts wegen
- II. Zeitpunkt
- III. Reihenfolge
- IV. Entscheidung
- 1. Abgesonderte Verhandlung
- 2. Rechtsmittel
- 3. Prüfungsreihenfolge
- 4. Rechtskraft
- 5. Ausnahmen
- 124–135 11. Kapitel. Das Verhalten des Beklagten zur Klage 124–135
- A. Der Antrag auf Klageabweisung
- I. Klageleugnen und Einwand fehlender Schlüssigkeit
- II. Einredeerhebung
- 1. Rechtshindernde Einreden
- 2. Rechtsvernichtende Einreden
- 3. Rechtshemmende Einreden
- III. Prozessaufrechnung
- 1. Rechtsnatur
- 2. Einzelfälle
- 3. Mehrere Gegenforderungen
- 4. Zurückweisung
- 5. Mehrfache Geltendmachung
- 6. Zuständigkeit
- 7. Streitwert
- 8. Rechtskraft
- 9. Vorbehaltsurteil
- B. Das Anerkenntnis
- I. Anerkenntnis als Urteilsgrundlage
- II. Arten des Anerkenntnisses
- 1. Teilanerkenntnis
- 2. Sofortiges Anerkenntnis
- 3. Beschränktes Anerkenntnis
- III. Klageverzicht
- C. Das Geständnis – Das Nichtbestreiten
- I. Form
- II. Inhalt
- 1. Tatsachen
- 2. Klagegegner
- III. Wirkung
- IV. Nichtbestreiten
- V. Erklärung mit Nichtwissen
- 136–151 12. Kapitel. Die Erledigung des Prozesses ohne Urteil 136–151
- A. Die Klagerücknahme
- I. Wirkungen der Klagerücknahme
- II. Voraussetzungen der Klagerücknahme
- 1. Form
- 2. Einwilligung des Beklagten
- III. Rücknahme wegen Wegfall des Klageanlasses
- B. Die Erledigung der Hauptsache
- I. Beiderseitige übereinstimmende Erledigungserklärung
- II. Einseitige Erledigungserklärung
- 1. Klage zulässig und begründet
- 2. Klage unzulässig oder unbegründet
- 3. Kein erledigendes Ereignis
- III. Sonderfälle
- 1. Erledigung nach An- aber vor Rechtshängigkeit
- 2. Erledigung vor Anhängigkeit
- 3. Einseitige Erledigungserklärung des Beklagten
- C. Der Prozessvergleich
- I. Bedeutung des Vergleichs
- 1. Vorteile
- 2. Gefahren
- II. Voraussetzungen
- 1. »Vor einem deutschen Gericht«
- 2. »Zwischen den Parteien«
- 3. »Zur Beilegung des Rechtsstreits«
- 4. »Über den Streitgegenstand«
- 5. »Im Wege gegenseitigen Nachgebens«
- 6. In gehöriger Form
- III. Wirkungen des Prozessvergleichs
- 1. Materiell-rechtlich
- 2. Prozessual
- IV. Typische Arten des Vergleichs
- 1. Vergleich unter Widerrufsvorbehalt
- 2. Ratenzahlungsvergleich mit Verfallklausel
- 3. Erlassvergleich
- V. Die Unwirksamkeit des Prozessvergleichs
- 1. Unwirksamkeit
- 2. Berufung auf Unwirksamkeit
- 3. Berufung auf den wirksamen Vergleich
- VI. Anwaltsvergleich
- VII. Notwendiger Einigungsversuch vor einer Gütestelle
- 152–164 13. Kapitel. Die Versäumung von Prozesshandlungen – Das Versäumnisverfahren 152–164
- A. Die Versäumung von Prozesshandlungen
- I. Grundsatz
- II. Wiedereinsetzung in den vorigen Stand
- 1. Anwendungsbereich
- 2. Ohne Verschulden
- 3. Frist
- 4. Entscheidung
- B. Das Versäumnisverfahren
- I. Allgemeine Voraussetzungen für ein Versäumnisurteil
- 1. Termin
- 2. Säumnis
- 3. Ordnungsgemäße Ladung
- 4. Sachurteilsvoraussetzungen
- II. Schlüssigkeit als Grundlage des Versäumnisurteils gegen Beklagten
- 1. Schlüssigkeit
- 2. Keine Schlüssigkeit
- 3. Fehlen allgemeiner Voraussetzungen
- III. Die Säumnis des Klägers
- 1. Versäumnisurteil
- 2. Sonstige Entscheidungen
- IV. Der Einspruch
- 1. Statthaftigkeit
- 2. Frist
- 3. Einspruchsschrift
- 4. Unzulässiger Einspruch
- 5. Wirkungen des zulässigen Einspruchs
- 6. Entscheidung nach zulässigem Einspruch
- V. Zweites Versäumnisurteil
- 1. Prüfungsumfang
- 2. Berufung gegen zweites Versäumnisurteil
- 3. Neuerliches (erstes) Versäumnisurteil
- VI. Säumnis beider Parteien, Entscheidung nach Lage der Akten
- 165–193 14. Kapitel. Der Beweis – Das Beweisverfahren – Die Beweismittel 165–193
- A. Grundbegriffe
- I. Beweis
- 1. Beweis und Glaubhaftmachung
- 2. Unmittelbarer und mittelbarer Beweis
- 3. Beweis des ersten Anscheins
- 4. Haupt- und Gegenbeweis
- II. Beweisantritt
- 1. Tatsachen
- 2. Rechtssätze
- 3. Erfahrungssätze
- III. Beweiserheblichkeit – Beweisbedürftigkeit
- 1. Klägerstation (Schlüssigkeitsprüfung)
- 2. Beklagtenstation (Erheblichkeitsprüfung)
- 3. Beweisbedürftigkeit
- 4. Ablehnung von Beweisanträgen
- IV. Beweisanordnung
- 1. Im Rahmen eines Prozesses
- 2. Selbstständiges Beweisverfahren
- V. Beweisaufnahme
- 1. Zuständigkeit
- 2. Parteiöffentlichkeit
- VI. Beweismittel
- VII. Beweiswürdigung
- 1. Freie Beweiswürdigung
- 2. Freie Überzeugungsbildung
- VIII. Behauptungs- und Beweislast
- B. Die einzelnen Beweismittel
- I. Der Augenschein (§§ 371–372a)
- II. Der Zeugenbeweis (§§ 373–401)
- 1. Zeuge – Sachverständiger – sachverständiger Zeuge
- 2. Abgrenzung Zeugenaussage – Parteivernehmung
- 3. Amtliche Auskunft
- 4. Zeugnispflicht
- 5. Zeugenvernehmung
- 6. Beeidigung
- III. Der Sachverständigenbeweis (§§ 402–414)
- 1. Grundlage der Begutachtung
- 2. Erstattung
- 3. Würdigung
- 4. Haftung
- 5. Prozessökonomie
- IV. Der Urkundenbeweis (§§ 415–444)
- 1. Urkunde
- 2. Vorlage der Urkunde
- 3. Echtheit
- 4. Formelle Beweiskraft
- 5. Materielle Beweiskraft
- V. Beweis durch Parteivernehmung (§§ 445–455)
- 1. Als Partei zu vernehmende Person
- 2. Anforderungen
- 3. Anordnung
- 4. Abgrenzung
- 194–206 15. Kapitel. Die gerichtlichen Entscheidungen 194–206
- A. Begriffe
- I. Prozesshandlungen des Gerichts
- 1. Urteile
- 2. Beschlüsse
- 3. Verfügungen
- II. Urteilsarten
- 1. Unterscheidung nach dem Inhalt
- 2. Unterscheidung nach der Wirkung auf die Instanz
- 3. Unterscheidung nach Bedingtheit
- B. Anforderungen an die Urteilsarten
- I. Das Endurteil
- II. Teilurteil
- 1. Teilbarkeit
- 2. Keine Gefahr von Widersprüchen
- 3. Ermessen
- 4. Entscheidung
- III. Das Zwischenurteil
- 1. Zwischenurteil über die Zulässigkeit
- 2. Einzelne prozessuale Zwischenstreitigkeiten
- 3. Grundurteil
- C. Erlass und Inhalt des Urteils
- I. Beratung – Abfassung – Verkündung
- 1. Unmittelbarkeit
- 2. Beratung
- 3. Verkündung
- II. Inhalt des Urteils
- 1. Schema
- 2. Tatbestand
- 3. Entscheidungsgründe
- D. Wirkungen des Urteils
- I. Bindung des (erkennenden) Gerichts
- 1. Negative Bindung
- 2. Positive Bindung
- II. Materielle Rechtskraft
- III. Gestaltungswirkung
- IV. Vollstreckbarkeit
- V. Tatbestandswirkung
- 207–231 16. Kapitel. Rechtsmittel 207–231
- A. Gemeinsame Grundsätze
- I. Zulässigkeit und Begründetheit
- II. Zulässigkeitsvoraussetzungen
- 1. Statthaftigkeit
- 2. Frist
- 3. Form
- 4. Beschwer
- 5. Wert des Beschwerdegegenstandes
- III. Verschlechterungsverbot – Anschlussrechtsmittel
- 1. Verschlechterungsverbot
- 2. Anschlussrechtsmittel
- 3. Abgrenzung zum selbstständigen Rechtsmittel
- IV. Rechtsmittelrücknahme – Rechtsmittelverzicht
- 1. Rechtsmittelrücknahme
- 2. Rechtsmittelverzicht
- V. Rechtsmittel gegen inkorrekte Entscheidungen
- B. Die Berufung
- I. Zulässigkeitsvoraussetzungen
- 1. Statthaftigkeit
- 2. Einlegungs- und Begründungsfrist
- 3. Form
- 4. Beschwer
- II. Das Verfahren in der Berufungsinstanz
- 1. Bindung an Anträge
- 2. Gegenstand der neuen Verhandlung
- 3. Tatsachenstoff im Berufungsverfahren
- 4. Beweisaufnahme
- III. Die Entscheidung des Berufungsgerichts
- 1. Verwerfung als unzulässig
- 2. Zurückweisung durch Beschluss
- 3. Zurückweisung durch Urteil
- 4. Erfolgreiche Berufung
- 5. Versäumnisurteil
- C. Die Revision
- I. Zulassungsrevision
- 1. Zulassungsgründe
- 2. Zulassung durch Berufungsgericht
- 3. Zulassung durch das Revisionsgericht
- II. Zulässigkeitsvoraussetzungen
- 1. Statthaftigkeit
- 2. Frist und Form
- 3. Beschwer
- III. Das Verfahren in der Revisionsinstanz
- 1. Ausschlussfunktion
- 2. Bindungsfunktion
- IV. Die Prüfung des Revisionsgerichts
- 1. »Gesetz«
- 2. Verletzung
- 3. Beruhen
- V. Die Entscheidung des Revisionsgerichts
- 1. Verwerfung als unzulässig
- 2. Zurückweisung als unbegründet
- 3. Zurückverweisung an das Berufungsgericht
- 4. Aufhebung und eigene Entscheidung
- 5. Säumnis
- D. Die Beschwerde
- I. Sofortige Beschwerde
- 1. Zulässigkeitsvoraussetzungen
- 2. Die Beschwerdeentscheidung
- II. Rechtsbeschwerde
- 1. Zulässigkeit
- 2. Verfahren
- 3. Entscheidung
- E. Anhang: Sicherstellung einheitlicher Entscheidungen
- I. Vermeidung divergierender Entscheidungen
- II. Vorlage an das Bundesverfassungsgericht
- III. Vorlage an den Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaft (EuGH)
- 232–245 17. Kapitel. Die (materielle) Rechtskraft 232–245
- A. Voraussetzungen der materiellen Rechtskraft
- I. Die formelle Rechtskraft
- 1. Keine Rechtsmittel statthaft
- 2. Ablauf der Rechtsbehelfsfrist
- 3. Verzicht
- II. Der Rechtskraft fähige Entscheidungen
- 1. Endurteile
- 2. Beschlüsse
- B. Wirkungen der materiellen Rechtskraft
- I. Zweiter Prozess über denselben Streitgegenstand
- II. Maßgeblichkeit des ersten Urteils für Vorfrage im zweiten Prozess
- C. Der sachliche (objektive) Umfang der materiellen Rechtskraft
- I. Gegenstand der Rechtskraft
- II. Keine Rechtskraft hinsichtlich der Entscheidungsgrundlagen
- 1. Präjudizielle Rechtsverhältnisse
- 2. Tatsachen und Rechtsverhältnisse
- 3. Einwendungen und Einreden
- III. Insbesondere: Urteil über eine Teilklage
- D. Der persönliche (subjektive) Umfang der materiellen Rechtskraft
- I. Parteien
- II. Rechtskrafterstreckung
- 1. Rechtsnachfolge
- 2. Weitere Fälle
- E. Der zeitliche Umfang der materiellen Rechtskraft
- I. Neue Tatsachen
- 1. Präklusion
- 2. »Zur Zeit unbegründet«
- 3. Versäumnisurteile
- 4. Abgrenzung zur rechtlichen Neubewertung
- II. Geltendmachung
- 1. Vollstreckungsabwehrklage (§ 767)
- 2. Abänderungsklage (§ 323)
- F. Durchbrechungen der Rechtskraft
- I. Die Wiederaufnahme des Verfahrens
- 1. Nichtigkeitsklage
- 2. Restitutionsklage
- 3. Wiederaufnahmeverfahren
- II. Durchbrechung der Rechtskraft nach § 826 BGB
- 246–258 18. Kapitel. Besondere Verfahrensarten 246–258
- A. Das Verfahren vor den Amtsgerichten (§§ 495–510b)
- I. Verfahren bei Unzuständigkeit
- II. »Bagatellverfahren«
- III. Handlungsurteil
- B. Das Mahnverfahren
- I. Mahnantrag
- II. Mahnbescheid
- III. Widerspruch des Antragsgegners
- IV. Vollstreckungsbescheid
- 1. Charakter
- 2. Einspruch
- 3. Rechtskraft
- C. Der Urkundenprozess
- I. Voraussetzungen
- 1. Ansprüche
- 2. Urkunde
- II. Vorbehalts- und Endurteil
- D. Das schiedsrichterliche Verfahren
- I. Bedeutung und Abgrenzung
- 1. Bedeutung
- 2. Abgrenzung
- II. Die Schiedsvereinbarung
- 1. Voraussetzungen
- 2. Kompetenz-Kompetenz des Schiedsgerichts
- 3. Unzulässigkeitsrüge im staatlichen Prozess
- 4. Schiedsrichtervertrag
- III. Verfahren und Entscheidung des Schiedsgerichts
- 1. Besetzung
- 2. Verfahren
- 3. Entscheidung
- IV. Verfahren vor dem staatlichen Gericht
- 1. Vollstreckbarerklärung
- 2. Aufhebung
- E. Mediation
- 259–267 19. Kapitel. Prozesskosten und Prozesskostenhilfe 259–267
- A. Die Gerichtskosten
- B. Die Vergütung des Rechtsanwalts (Anwaltskosten)
- C. Prozessuale Kostenerstattung (Kostenentscheidung – Kostenfestsetzung)
- I. Kostengrundentscheidung
- II. Kostenfestsetzungsbeschluss
- III. Vollstreckung
- IV. Materiell-rechtlicher Kostenerstattungsanspruch
- 1. Gläubiger
- 2. Schuldner
- 3. Extreme Aufwendungen
- D. Die Prozesskostenhilfe
- I. Voraussetzungen
- 1. Wirtschaftliche Verhältnisse
- 2. Erfolgsaussicht
- 3. Keine Mutwilligkeit
- II. Verfahren
- 1. Antrag
- 2. Gelegenheit zur Stellungnahme
- 3. Entscheidung
- 4. Instanz
- III. Wirkungen der Bewilligung
- 1. Befreiung von den Gerichtskosten
- 2. Beiordnung eines Anwalts
- 3. Kostenrisiko bei Prozessverlust
- 4. Erleichterungen für Prozessgegner
- 5. Aufhebung
- IV. Die Beratungshilfe
- 268–278 20. Kapitel. Internationales Zivilprozessrecht 268–278
- A. Grundlagen
- I. Begriff und Bedeutung
- II. Völkerrechtliche Grundlagen
- III. Rechtsquellen
- B. Internationale Zuständigkeit
- I. Allgemeiner Gerichtsstand
- II. Besondere Gerichtsstände
- 1. Vertragsgerichtsstand
- 2. Deliktsgerichtsstand
- 3. Streitgenossenschaft, Widerklage, Aufrechnung
- 4. Verbrauchersachen
- 5. Ausschließliche Gerichtsstände
- 6. Zuständigkeit kraft Parteiverhaltens
- III. Prüfung durch das Gericht
- IV. Anhängigkeit mehrerer Verfahren
- C. Weitere Regelungsgegenstände
- I. Zustellung
- II. Ausländisches Recht
- III. Beweis
- IV. Anerkennung
- 279–300 Stichwortverzeichnis 279–300
- 301–301 Impressum 301–301